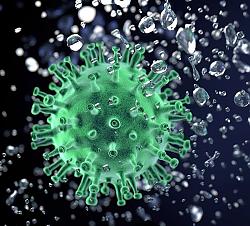Zu den herausragenden Ergebnissen der Studie gehört die Erkenntnis, dass 55 Prozent der Unternehmen nach dem Gefühl der Entscheider mit der Digitalisierung noch am Anfang stehen oder gerade mal erste Schritte unternehmen; erst 12 Prozent haben die Hälfte oder mehr des Weges geschafft haben. Nicht gerade neue Erkenntnisse und auch keine, die besonders belastbar wären. Wie soll jemand eigentlich die zurück gelegte Wegstrecke beurteilen, wenn er gar nicht genau weiß, welche Herausforderungen zu bewältigen sind?
Die meisten Entscheider betrachten die Digitalisierung als große Herausforderung, die ihren Mitarbeitern ungewöhnlich Fähigkeiten abverlangt. Auch das hat man schon mal irgendwo gelesen. Aber immerhin haben wir es jetzt schwarz auf weiß: Männer sind die größeren Angsthasen: 35 Prozent der befragten Männer, aber nur 28 Prozent der Frauen haben Angst vor der Digitalisierung, die Hälfte der Entscheider empfindet sie als Wagnis und drei Viertel betrachten sie als rationale Pflichtveranstaltung. Was wäre denn die wünschenswerte Alternative? Der Entscheider als Digitalisierungs-Freak?
Wenn die Hälfte der Befragten die Digitalisierung als Wagnis betrachtet, darf man nach der Regel des halbvollen bzw. halbleeren Glases wohl annehmen, dass die andere Hälfte eher die Chancen sieht. Positive Emotionen löst die Digitalisierung besonders bei IT, Human Resources und Marketing aus, während Management und Controlling das Thema nüchterner sehen. Gleichzeitig bestehen in der IT „interessanterweise“ die größten Vorbehalte, wie die Autoren der Studie anmerken. Interessanter wäre es meines Erachtens gewesen, wenn sie versucht hätten, diesen Widerspruch aufzulösen, der ein klassischer Fall von Schizophrenie zu sein scheint. Aber das ist gar nicht ihre eigentliche Intention.
Wie bei den meisten dieser Studien dieser Art geht es in erster Linie darum, Kompetenz zu demonstrieren, um Beratung oder ähnliche Dienste zu verkaufen. Und dazu muss man den Kunden erst mal klar machen, dass sie dringend Beratung benötigen. Wenn man die vielen Studien über die Herausforderungen von Industrie 4.0, Internet of Things oder Digitalisierung für mittelständische Unternehmen als Maßstab nimmt, muss das Beratungsgeschäft im Mittelstand boomen.
Hinter der Innovation Alliance steckt ein Bündnis von Technologieanbieter Cisco und elf mittelständischen, deutschen IT-Unternehmen, die sich zusammengetan haben, um dem Mittelstand bei der Digitalisierung zu helfen. Das ist durchaus legitim, und ich will auch nicht in Abrede stellen, dass viele Mittelständler bei der digitalen Transformation durchaus etwas Unterstützung brauchen können. Nur wage ich zu bezweifeln, dass die Studie darüber Aufschluss gibt, wo genau sie unterstützt werden sollten. Es sei denn, man will sie erst mal zum Psychologen schicken, damit er ihnen etwas mehr Zuversicht macht.
Wer die falschen Fragen stellt bekommt oft falsche Antworten, d.h. Antworten, die nicht brauchbar sind. Der Skepsis des Mittelstands ist nicht mit Psychologie beizukommen, sondern mit klaren Rezepten, welche Schritte die Unternehmen wählen sollten, um die Chancen der Digitalisierung optimal zu nutzen. Am besten gleich mit einem Beipackzettel über die möglichen Auswirkungen und Nebenwirkungen.
Bedenklich stimmt mich eine Erkenntnis der Studie, die das Digital Business Magazin eher am Rande erwähnt, obwohl sie meiner Ansicht nach im Mittelpunkt stehen sollte. In die Digitalisierungsentscheidungen sind an erster Stelle die IT und an zweiter das Management involviert, gefolgt von Produktion, Vertrieb und Marketing. Was ist eigentlich mit der Produktentwicklung, frage ich mich? Die Studie erwähnt zwar, dass die Entscheider in Forschung & Entwicklung der Digitalisierung gelassener gegenüberstehen als z.B. die Produktion, vermittelt aber den Eindruck, dass sie bei den Entscheidungen dann nicht gehört werden. Das ist nicht ganz schlüssig.
Auch dem bodenständigsten Mittelständler dürfte klar sein, dass die digitale Transformation nur gelingen kann, wenn sie da ansetzt, wo die meisten Produktdaten in digitaler Form entstehen. Die Digitalisierung der Produktentwicklung und die Schaffung eines digitalen Masters sind zwingende Voraussetzung für die durchgängige Nutzung der digitalen Produktdaten über alle Phasen des Produktlebenszyklus hinweg. Ohne digitalen Master gibt es z.B. keinen digitalen Zwilling, mit dem sich Produkte unter Nutzung von Sensordaten aus dem Betrieb simulieren und optimieren lassen. Wenn die Digitalisierung in den Köpfen der Entscheider anfängt, wie die Studie postuliert, dann würde mich an erster Stelle interessieren, was die Entscheider in der Produktentwicklung über diese Themen denken.