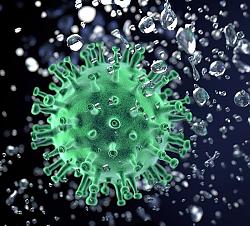Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Es geht letztlich darum den Reifegrad von Produkten und Produktionssystemen mit Hilfe digitaler Techniken in den frühen Entwicklungsphasen zu erhöhen und die digitalen Informationen dann prozessdurchgängig zu nutzen, um in den späteren Entwicklungsphasen Zeit zu sparen, kostspielige Änderungen zu vermeiden und einen sanfteren Übergang in die reale Produktionswelt zu ermöglichen. Ultimatives Ziel des digitalen Frontloadings ist also die Verkürzung von Time to Market und Time to Profit. Das setzt allerdings voraus, dass die Unternehmen bereit sind, vorne im Prozess mehr Zeit und Geld zu investieren. Sind sie das wirklich? Ich wage das manchmal zu bezweifeln.
Die schlecht integrierten PLM-Datensilos in vielen Unternehmen, die eine durchgängige Nutzung der digitalen Informationen erschweren, sind nicht die Wurzel des Übels, sondern ein Symptom. Ein Symptom für das ausgeprägte Abteilungs- bzw. Kostenstellendenken in Verbindung mit einer IT-Organisation, die als „Dienstleister“ vorrangig die Projekte umsetzt, die der jeweiligen Fachabteilung als Auftraggeber den größten Nutzen versprechen; aber nicht notwendigerweise dem ganzen Unternehmen. Darunter leiden vor allem radikale Frontloading-Projekte wie die Implementierung von Werkzeugen und Methoden des Model Based Systems Engineerings (MBSE), die für die implementierenden Abteilungen einen Mehraufwand bedeutet, von dem in erster Linie die nachgelagerten Prozessschritte und Abteilungen profitieren. Zumindest kurz- bis mittelfristig.
Aber man braucht sich gar nicht so weit nach vorne im Prozess zu wagen. Neulich sprach ich mit dem Leiter der technischen Dokumentation eines größeren mittelständischen Unternehmens, das unter anderem kundenspezifische Anlagen für die Leiterplatten- und Halbleiterindustrie herstellt. Ein erfolgreiches, sehr engineering-getriebenes Unternehmen, dessen Konstrukteure ihre mechanischen Produktdaten aber immer noch mit einem Excel-Konstrukt verwalten, obwohl sie eigentlich ein PDM-System nutzen könnten, das schon im Hause ist. Sie können sich offensichtlich nur schwer von ihren lieb gewonnen Arbeitsweisen trennen. Das hat unter anderem zur Folge, dass die CAD-Modelle nicht prozessdurchgängig für die Dokumentationserstellung genutzt werden können, sondern manuell aufbereitet und bereitgestellt werden müssen.
Ab einer bestimmten Unternehmensgröße wird nur noch in Kostenstellen gedacht, was zu massiven Reibungsverlusten führt, urteilte mein Gesprächspartner. Ich kann mich seinem Urteil nur anschließen, denn ich erlebe bei meinen Anwenderinterviews immer wieder Medienbrüche an den Nahtstellen zwischen verschiedenen Abteilungen, notabene zwischen Konstruktion und Fertigung bzw. Arbeitsvorbereitung aber auch zwischen Konstruktion und Qualitätssicherung, die in erster Linie darauf zurückzuführen sind, dass die Abteilungen nicht gesamtheitlich denken. Und darauf, dass das Management zu wenig darauf drängt, dass im Sinne der Digitalisierung gesamtheitlich gedacht wird. Wenn man jetzt noch berücksichtigt, dass der Service in vielen Unternehmen IT-technisch und organisatorisch ein ausgeprägtes Eigenleben führt, stelle ich mir wirklich die Frage, wie das mit der digitalen Transformation der Geschäftsprozesse und -modelle eigentlich funktionieren soll?
Vielleicht muss man den Spieß einfach umdrehen. Bevor die Unternehmen über den Umbau ihrer PLM- und IT-Landschaften nachdenken, sollten sie sich erst mal über den Umbau ihrer Organisationsstrukturen Gedanken machen und neue Führungskonzepte für das digital vernetzte Unternehmen entwickeln. Michael Porter, Prof. an der Harvard Business School, und PTC CEO Jim Heppelmann haben das schon vor zwei Jahren in einem Beitrag mit dem Titel Wie smarte Produkte Unternehmen verändern angeregt:
Unternehmensfunktionen von Fertigungsbetrieben müssen aufgrund der zunehmenden Vernetzung von Produkten und Maschinen auf eine neue Art und Weise zusammenarbeiten. Deshalb verändern sich die Organisationsstrukturen der Unternehmen rapide. Eine neue Abteilung für Datenmanagement beginnt sich durchzusetzen, und es entstehen erste Abteilungen, die sich speziell um die kontinuierliche Weiterentwicklung von Produkten oder um den Erfolg der Kunden kümmern.
Die Autoren schlagen eine zentrale Datenabteilung vor, geführt von einem Chief Data Officer (CDO), der sich auf Konzernebene um die Datenerhebung und -analyse kümmert, die Analysten der einzelnen Bereiche unterstützt und Informationen und Erkenntnisse im gesamten Unternehmen bereitstellt. Forbes spricht stattdessen von Chief Digital Officer, was die Sache eigentlich besser trifft. Die Kernfrage jedoch ist, mit welchen Kompetenzen und Ressourcen diese neuen Funktionen ausgestattet werden.
Ich bin mir auch nicht so sicher, ob man die Mauern zwischen den Abteilungen einreißt, indem man neue Abteilungen schafft. Gerade in Deutschland, wo einer Untersuchung von Kienbaum zufolge die meisten Unternehmen noch eine klassische Organisationsstruktur haben; nur drei Prozent der befragten Führungskräfte angaben, in einer agilen Organisation zu arbeiten. Was wir dringender brauchen als neue Abteilungen und Funktionen ist ein Mindchange in den Köpfen der Mitarbeiter und Führungskräfte. Sie müssen lernen, dass die digitale Transformation eine Gemeinschaftsaufgabe und eine kritische Mission ist. Digitalisierung geht alle an.